Zufall, Witz und Schweigen
Die Stuttgarter Staatsgalerie widmet dem Komponisten und bildenden Künstler John Cage zum 100. Geburtstag eine Ausstellung
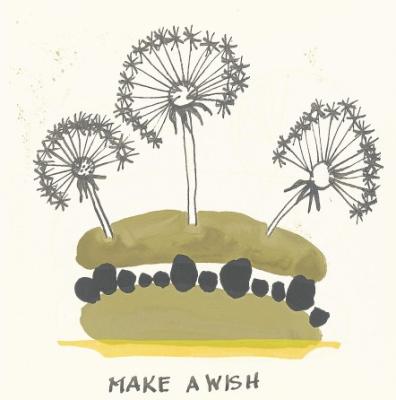
Stuttgart - Das ist vielleicht das schönste Exponat, das die John-Cage-Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart zu bieten hat: Das „Mud Book“, ein Klappbilderbuch, das zum Backen eines Matschkuchens anleitet: Schlamm formen, in der Sonne trocknen lassen, schichten, mit Steinchen füllen und Pusteblumen draufstecken - und schon ist die Geburtstagstorte fertig, inklusive Wunscherfüllung beim Ausblasen der Löwenzahnlichtlein. Aber Vorsicht: „Mud pies are to make and to look at. Not to eat“, lautet das mahnende Schlusswort.
Die Staatsgalerie gratuliert mit ihrer aktuellen Ausstellung „It‘s John. John Cage“, die noch bis zum 11. November im Graphik-Kabinett zu sehen ist, dem großen musikalischen Avantgardisten und Kunstrevolutionär zum 100. Geburtstag. Schade, dass der Amerikaner eine Matschtorte nicht mehr in Empfang nehmen kann. Er starb am 12. August 1992.
Cage hat das „Mud Book“ in den 1950er Jahren mit der Künstlerin Lois Long als Kinderbuch verfasst, fand aber keinen Verleger. Cage hatte die Texte beigesteuert, Long die Zeichnungen aus Gouache und Wasserfarben. Erst 1983, als Cage längst berühmt war, erschien das Werk als aufwendige Künstlerbuchausgabe in Siebdrucktechnik.
Katalysator und Kommunikator
Auch wenn dies bloß eine Gelegenheitsarbeit war - interessant ist sie, weil sie zwei wichtige Charaktereigenschaften von Cage zutage fördert: seinen feinen Humor, der ins Subversive anwachsen konnte und dann dem Kultur-Establishment dieser Welt den Bierernst austrieb, und seine besondere Fähigkeit zur kongenialen Zusammenarbeit mit anderen Kreativen, die ihn zum Katalysator und Kommunikator ganzer Bewegungen machte, sei es in Sachen Happening, Popart oder Fluxus.
Diese beiden Pole seines Wesens werden in den Glaskästen der Ausstellung geschickt inszeniert, mit Vorarbeiten zu Buch-Projekten Cages oder Archivmaterial, das etwa seine Leidenschaft fürs Pilzesammeln dokumentiert: etwa mit Fotos von Pilzexkursionen oder Einladungsschreiben zur Jahresversammlung der 1962 von ihm gegründeten New Yorker Mycological Society.
An der Wand dann der eigentliche Grund der Ausstellung: Bildkünstlerische Arbeiten des berühmten Komponisten aus dem Besitz der Staatsgalerie, vor allem Graphisches, das ab Ende der 1960er Jahre in seinem Werk an Bedeutung gewinnt - eine Entwicklung, die nicht überrascht, betrachtet man den hohen graphischen Eigenwert vieler seiner Partituren. Wobei er bei den Entwürfen für die Kunstdrucke mit Methoden experimentierte, die er in seinen Kompositionen bereits gründlich erprobt hatte: die Arbeit mit Zufallsoperationen, die berechnet werden nach dem Prinzip des I-Gings, einer mit Münzwurf arbeitenden traditionellen chinesischen Orakelform. Sichtbar wird das etwa in den diversen Zeichnungen und Radierungen der Blattreihe „Where R = Ryoanji“, die variationsreich Bezug nimmt auf den Steingarten des zen-buddhistischen japanischen Tempels Ryoanji.
Auf einer analog zu diesem Garten definierten rechteckigen Fläche umkreiste der Bleistift oder die Radiernadel wiederholt 15 Steine. Die Positionen der Steine und die Art und Weise der Umkreisung berechnete Cage zuvor per Zufallsprinzip. Das Ergebnis ist ein lockeres bis sehr verdichtetes Wirrwarr aus Linien und Kreisen, das jedoch streng eingegrenzt wird durch die Konturen des Rechtecks. Diese graphischen Arbeiten inspirierten Cage 1983/85 wiederum zu einem einstündigen musikalischen Werk, dem man, angedockt an die kleine Hörstation der Ausstellung, vor Ort entspannt lauschen kann.
Das Zufallsprinzip à la I-Ging setzte Cage auch beim wohl bedeutendsten Exponat der Ausstellung ein: „Not wanting to say anything about Marcel“, einem kleinen Objekt aus acht eng hintereinander gereihten Plexiglasscheiben, die jeweils mit unterschiedlichen Buchstaben und Wortfetzen bedruckt sind, die per Zufall aus Katalogen und Lexika ermittelt wurden: eine Hommage an den 1968 verstorbenen Freund und Künstler Marcel Duchamp, der etwa durch seine Ready-mades „Fahrrad-Rad“ und „Flaschentrockner“ berühmt geworden war und in dessen Werk der Zufall ebenfalls eine bedeutende Rolle gespielt hat; Cage war das stets eine Inspirationsquelle. So verwandelte Cage selbst die Tatsache, dass sich Duchamp zeitweise aus der Kunstszene zurückzog, um sich ausschließlich dem Schach zu widmen, in eine künstlerische Aktion und traf sich mit ihm zu einem öffentlichen Spiel. Natürlich war das Schachbrett präpariert, und jeder Zug lieferte Töne und Geräusche für eine gerade entstehende, imaginäre Partitur.
Freundlich lächelnd am Telefon
Gelungen ist diese Cage-Ausstellung nicht nur, weil sie Raritäten zeigt, etwa eine kleine, nie veröffentlichte Fotogeschichte, die ursprünglich als Werbebroschüre zu Cages 1969 erschienenem Buch „Notations“ gedacht war, einer von Cage angelegten Sammlung von handschriftlichen graphischen Notationen verschiedener Komponisten und bildender Künstler. Eines dieser Fotos, die alle den freundlich lächelnden Cage am Telefon zeigen, ziert übrigens auch das Plakat der Ausstellung. Gelungen ist diese aber auch, weil sie den Komponisten Cage nicht unter den Tisch fallen lässt, sondern ihn in einem ausgewogenem Konzert-Rahmenprogramm zur Geltung bringt. Empfohlen sei auch die Teilnahme an einer öffentlichen Führung - jeden Sonntag um 12 Uhr.
* Die Ausstellung im Graphik-Kabinett der Stuttgarter Staatsgalerie ist noch bis 11. November geöffnet. Die Kunstnacht am Samstag, 10. November (18 bis 24 Uhr), ist John Cage gewidmet. In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart werden dann auch verschiedene Kompositionen von Cage für Schlagzeug aufgeführt.
* www.staatsgalerie.de
Besprechung für die Eßlinger Zeitung von heute.
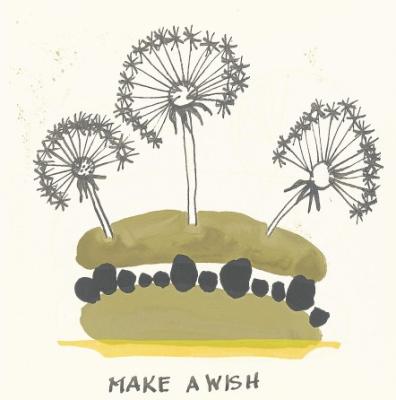
Stuttgart - Das ist vielleicht das schönste Exponat, das die John-Cage-Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart zu bieten hat: Das „Mud Book“, ein Klappbilderbuch, das zum Backen eines Matschkuchens anleitet: Schlamm formen, in der Sonne trocknen lassen, schichten, mit Steinchen füllen und Pusteblumen draufstecken - und schon ist die Geburtstagstorte fertig, inklusive Wunscherfüllung beim Ausblasen der Löwenzahnlichtlein. Aber Vorsicht: „Mud pies are to make and to look at. Not to eat“, lautet das mahnende Schlusswort.
Die Staatsgalerie gratuliert mit ihrer aktuellen Ausstellung „It‘s John. John Cage“, die noch bis zum 11. November im Graphik-Kabinett zu sehen ist, dem großen musikalischen Avantgardisten und Kunstrevolutionär zum 100. Geburtstag. Schade, dass der Amerikaner eine Matschtorte nicht mehr in Empfang nehmen kann. Er starb am 12. August 1992.
Cage hat das „Mud Book“ in den 1950er Jahren mit der Künstlerin Lois Long als Kinderbuch verfasst, fand aber keinen Verleger. Cage hatte die Texte beigesteuert, Long die Zeichnungen aus Gouache und Wasserfarben. Erst 1983, als Cage längst berühmt war, erschien das Werk als aufwendige Künstlerbuchausgabe in Siebdrucktechnik.
Katalysator und Kommunikator
Auch wenn dies bloß eine Gelegenheitsarbeit war - interessant ist sie, weil sie zwei wichtige Charaktereigenschaften von Cage zutage fördert: seinen feinen Humor, der ins Subversive anwachsen konnte und dann dem Kultur-Establishment dieser Welt den Bierernst austrieb, und seine besondere Fähigkeit zur kongenialen Zusammenarbeit mit anderen Kreativen, die ihn zum Katalysator und Kommunikator ganzer Bewegungen machte, sei es in Sachen Happening, Popart oder Fluxus.
Diese beiden Pole seines Wesens werden in den Glaskästen der Ausstellung geschickt inszeniert, mit Vorarbeiten zu Buch-Projekten Cages oder Archivmaterial, das etwa seine Leidenschaft fürs Pilzesammeln dokumentiert: etwa mit Fotos von Pilzexkursionen oder Einladungsschreiben zur Jahresversammlung der 1962 von ihm gegründeten New Yorker Mycological Society.
An der Wand dann der eigentliche Grund der Ausstellung: Bildkünstlerische Arbeiten des berühmten Komponisten aus dem Besitz der Staatsgalerie, vor allem Graphisches, das ab Ende der 1960er Jahre in seinem Werk an Bedeutung gewinnt - eine Entwicklung, die nicht überrascht, betrachtet man den hohen graphischen Eigenwert vieler seiner Partituren. Wobei er bei den Entwürfen für die Kunstdrucke mit Methoden experimentierte, die er in seinen Kompositionen bereits gründlich erprobt hatte: die Arbeit mit Zufallsoperationen, die berechnet werden nach dem Prinzip des I-Gings, einer mit Münzwurf arbeitenden traditionellen chinesischen Orakelform. Sichtbar wird das etwa in den diversen Zeichnungen und Radierungen der Blattreihe „Where R = Ryoanji“, die variationsreich Bezug nimmt auf den Steingarten des zen-buddhistischen japanischen Tempels Ryoanji.
Auf einer analog zu diesem Garten definierten rechteckigen Fläche umkreiste der Bleistift oder die Radiernadel wiederholt 15 Steine. Die Positionen der Steine und die Art und Weise der Umkreisung berechnete Cage zuvor per Zufallsprinzip. Das Ergebnis ist ein lockeres bis sehr verdichtetes Wirrwarr aus Linien und Kreisen, das jedoch streng eingegrenzt wird durch die Konturen des Rechtecks. Diese graphischen Arbeiten inspirierten Cage 1983/85 wiederum zu einem einstündigen musikalischen Werk, dem man, angedockt an die kleine Hörstation der Ausstellung, vor Ort entspannt lauschen kann.
Das Zufallsprinzip à la I-Ging setzte Cage auch beim wohl bedeutendsten Exponat der Ausstellung ein: „Not wanting to say anything about Marcel“, einem kleinen Objekt aus acht eng hintereinander gereihten Plexiglasscheiben, die jeweils mit unterschiedlichen Buchstaben und Wortfetzen bedruckt sind, die per Zufall aus Katalogen und Lexika ermittelt wurden: eine Hommage an den 1968 verstorbenen Freund und Künstler Marcel Duchamp, der etwa durch seine Ready-mades „Fahrrad-Rad“ und „Flaschentrockner“ berühmt geworden war und in dessen Werk der Zufall ebenfalls eine bedeutende Rolle gespielt hat; Cage war das stets eine Inspirationsquelle. So verwandelte Cage selbst die Tatsache, dass sich Duchamp zeitweise aus der Kunstszene zurückzog, um sich ausschließlich dem Schach zu widmen, in eine künstlerische Aktion und traf sich mit ihm zu einem öffentlichen Spiel. Natürlich war das Schachbrett präpariert, und jeder Zug lieferte Töne und Geräusche für eine gerade entstehende, imaginäre Partitur.
Freundlich lächelnd am Telefon
Gelungen ist diese Cage-Ausstellung nicht nur, weil sie Raritäten zeigt, etwa eine kleine, nie veröffentlichte Fotogeschichte, die ursprünglich als Werbebroschüre zu Cages 1969 erschienenem Buch „Notations“ gedacht war, einer von Cage angelegten Sammlung von handschriftlichen graphischen Notationen verschiedener Komponisten und bildender Künstler. Eines dieser Fotos, die alle den freundlich lächelnden Cage am Telefon zeigen, ziert übrigens auch das Plakat der Ausstellung. Gelungen ist diese aber auch, weil sie den Komponisten Cage nicht unter den Tisch fallen lässt, sondern ihn in einem ausgewogenem Konzert-Rahmenprogramm zur Geltung bringt. Empfohlen sei auch die Teilnahme an einer öffentlichen Führung - jeden Sonntag um 12 Uhr.
* Die Ausstellung im Graphik-Kabinett der Stuttgarter Staatsgalerie ist noch bis 11. November geöffnet. Die Kunstnacht am Samstag, 10. November (18 bis 24 Uhr), ist John Cage gewidmet. In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart werden dann auch verschiedene Kompositionen von Cage für Schlagzeug aufgeführt.
* www.staatsgalerie.de
Besprechung für die Eßlinger Zeitung von heute.
eduarda - 10. Aug, 10:30
